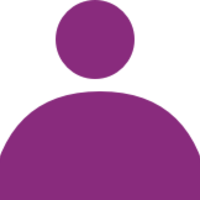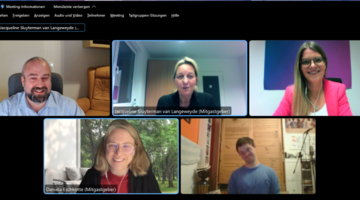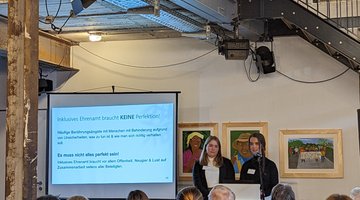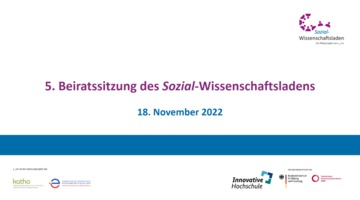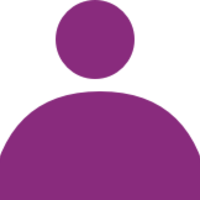

Dr. Sigrid Arnade (Berlin) war bis 2020 Geschäftsführerin der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland e.V. Aus der Perspektive einer Aktivistin schilderte sie eindrücklich die Geschichte der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung. Anhand bewusst provokanter Protestaktionen verdeutlichte sie, wie und wofür die Bewegung gekämpft hat – von der Gründung erster sich selbst so bezeichnender “Krüppelgruppen“ (1977) bis hin zur Gründung des ersten deutschen Zentrums für Selbstbestimmtes Leben (ZSL) in Bremen im Jahr 1986. Es folgte eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Konzept der Selbstbestimmung, der Leitidee der Bewegung. Frau Dr. Arnade hat sich in ihrer Vergangenheit insbesondere für die Rechte von Frauen mit Behinderung eingesetzt und diese bei den Verhandlungen zur UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) im Jahr 2006 vertreten. Sie berichtete lebhaft von den Verhandlungen in New York und welche Fortschritte dadurch erzielt werden konnten. Abschließend analysierte sie kritisch die Umsetzung und Anwendung im deutschen Recht, u.a. in Form des Bundesteilhabegesetzes.
In der anschließenden Podiumsdiskussion bezogen zusätzlich Frau Birgit Edler (ehemalige Geschäftsführerin der Ambulanten Dienste Münster e.V.) und Oliver Schneider (Mitarbeiter im Münsteraner Kompetenzzentrum Selbstbestimmt Leben) Stellung. Insbesondere die rechtliche Umsetzung der UN-BRK stand hier zur Diskussion. Der sogenannte Mehrkostenvorbehalt beispielsweise führt bis heute dazu, dass insbesondere Menschen mit höherem Unterstützungsbedarf (z. B. bei kognitiven oder komplexen Beeinträchtigungen) häufig die Chance verwehrt wird, in ihrer einigen Wohnung zu leben, wenn die ambulante Versorgung mehr kostet als ein stationäres Wohnheim. Zudem wurde diskutiert, welchen Einfluss die aktuelle Pandemie auf die Möglichkeiten eines selbstbestimmten Lebens hat. Auch die Diskussion um die gewollte oder korrekte Selbst- und Fremdbezeichnung von Personenkreisen bekam ihren Platz. Sigrid Arnade verwies auf die “Krüppelbewegung“: Bezeichnungen allein werden Diskriminierungserfahrungen nicht verändern. Lisa Kieselmann, die begleitend die Diskussion zeichnete, brachte die Diskussion mit ihrem „Schau“- Bild auf den Punkt.
Insgesamt sind enorme Fortschritte in Bezug auf die Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderung erzielt worden – gerade weil Männer und Frauen mit Behinderung sich seit einigen Jahrzehnten selbst für Ihre Rechte einsetzen. Gleichzeitig klafft eine riesige Lücke zwischen dem Leitbild von einer inklusiven Gesellschaft und der Realität. Wie man heute Selbstvertretung stärken könne, fragten sich die Teilnehmenden am Schluss.
Das Institut für Teilhabeforschung der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen (katho) und das Innovation-Lab Münster haben das 10-jährige Jubiläum des Inkrafttretens der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland im Jahr 2019 zum Anlass genommen, die Themenreihe “Exklusion und Inklusion – früher und heute“ ins Leben zu rufen. Die Themenreihe hat das Ziel, sich mit geschichtlichen Aspekten der Inklusionsdebatte auseinanderzusetzen. Die Reihe wird voraussichtlich im Herbst zum Thema “inklusives Wohnen“ fortgesetzt. Bei Interesse wenden Sie sich gerne an Daniela Eschkotte: d.eschkotte@katho-nrw.de.
Kontakt