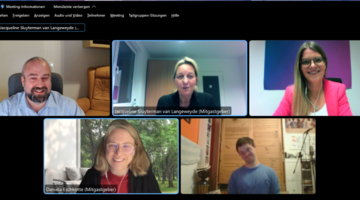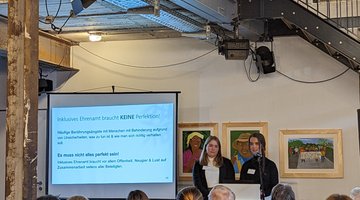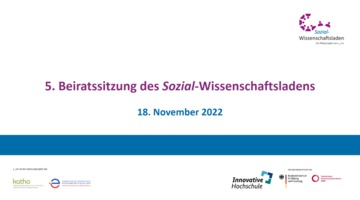Rassismus und Diskriminierung durch Sprache aus wissenschaftlicher Perspektive
Den Anfang machte die Gleichstellungsbeauftragte der katho-Abteilung Aachen, Prof.´in Dr. Marion Gerards mit einer thematischen Einführung anhand von Beispielen aus dem Hochschulalltag.
Dr. Jobst Paul, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung (DISS), setzte sich in seinem Vortrag vertiefend mit sprachlichen Formen der Herabsetzung und Ausgrenzung auseinander. Zunächst ging er auf die sozialpsychologischen Aspekte ein, um dann das Funktionieren der sprachlichen Technik zu analysieren, durch die illegitime Macht hergestellt werde. Eindrücklich arbeitete er heraus, dass in demagogischen Texten immer eine positiv beschriebene Wir-Gruppe ("zivilisiert") sich herabsetzend über eine feindliche Sie-Gruppe äußere, die als "schlecht", "nicht-zivilisiert" charakterisiert werde. Paul verwies auf die moralphilosophische und -theologische Tradition, die diese Wir- versus Sie-Geschichte, die Gut- versus Böse-Geschichte seit vielen Jahrhunderten erzähle: "Das nötigt zu der sehr dramatischen Feststellung, dass dehumanisierende Sprache nicht von der polemischen Tradition westlicher und christlicher Argumente abweicht, sondern aus dieser Tradition hervorgeht."
Der Blick aus der Praxis
Nach einer kurzen Pause setzte sich Tina Adomako, Promotorin im Eine Welt Netz NRW und ehemaliges Vorstandsmitglied der neuen deutschen Medienmacher_innen, in ihrem Vortrag über die "Macht der Worte. Sprache in der Migrationsgesellschaft" mit dem alltäglichen und medialen diskriminierenden Sprachgebrauch auseinander, der sich in Schimpfwörtern oder in rassistischen Witzen direkt zeige; der aber auch subtil passiere, indem Personengruppen systematisch nicht erwähnt würden oder indem von ihnen nicht wie von Personen, sondern von "Objekten" gesprochen werde.
In der anschließenden Podiumsdiskussion konnte der Moderator Serge Palasie, Afrikanist und Fachpromoter für Flucht, Migration und Entwicklung beim Eine Welt Netz NRW, zwei weitere Diskutant_innen begrüßen, die in ihren Inputs Einblicke gaben, welche Bedeutung rassistisches Sprechen in ihren Arbeitsfeldern besitzt. Emilene Wopana Mudimu, Sozialpädagogin und Leiterin des Aachener Jugend- und Kulturzentrums KingzCorner, berichtete von ihren Erfahrungen und legte einen Schwerpunkt auf empowernde Wirkung von HipHop für Jugendliche, die in ihrem Alltag Diskriminierungserfahrungen machen. Susanne Bücken, Rassismusforscherin und Geschäftsführerin des Café Zuflucht Aachen, thematisierte sprachliche Diskriminierungen, die Menschen im Rahmen ihres Asylverfahrens in Ämtern machten und die den Diskurs um Flucht und Migration prägen.
Rege Beteiligung der Zuhörer_innen
Zahlreiche Wortmeldungen aus dem Publikum drehten sich um weitere Erfahrungen rassistischen Sprechens, aber auch um Fragen des korrekten, rassismuskritischen Sprachgebrauchs, um Fragen nach den (sozial-)pädagogischen Konsequenzen, die sich für Professionelle in sozialen und pädagogischen Handlungsfeldern ergeben, und um Fragen, wie jede_r im eigenen Alltag aufgefordert ist, sich rassismuskritisch zu positionieren – auch und gerade in Bezug auf herabsetzende Sprache. Nach Abschluss der Podiumsdiskussion wurde diese Diskussion an digitalen Stehtischen mit den Referent_innen und interessierten Teilnehmer_innen noch in kleineren Gruppen fortgeführt.
Wir danken allen Teilnehmenden und freuen uns auf die nächste Auflage des erfolgreichen Formats!
Kontakt